Dieser Netzauftritt verwendet Sitzungs-Cookies
Näheres erfahren Sie in der Datenschutzerklärung.
Der Blog des Goldseelchen-Verlags
Erkenntnisse aus Stevensons Novelle
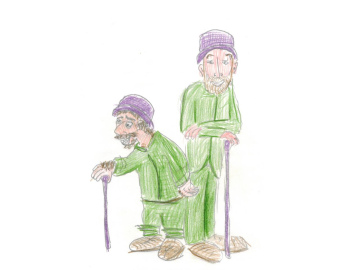
Berühmte Geschichten bringen mit sich, dass man von ihnen schon weiß, ehe man sie gelesen hat. „Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ des genialen schottischen Schriftstellers Robert Louis Stevenson gehört für mich dazu. Natürlich wusste ich von der Novelle aus dem Englischunterricht. Irgendjemand wird damals sicher ein Referat gehalten haben.
In manchen Filmen begegnete mir dann das Duo Jekyll-Hyde. Zum Beispiel als übertrieben großes Monster im genauso übertriebenen Steampunk-Film „Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen“. Ich erinnere mich an einen Ringelpullover und einen Darsteller mit roten Haaren; mehr weiß ich nicht mehr. Bei der Bully-Herbig-Verfilmung „Hui Buh, das Schlossgespenst“ hat Dr. Jekyll in der Stadt der Toten eine Art Cameo-Auftritt. Hui Buh kommentiert: „Dr. Jekyll, Mr. Hyde! Cooler Typ!“ Aus diesen und anderen Adaptionen entstand in meinem Kopf Mr. Hyde als ein tobendes, nicht zu bändigendes Wesen, wie ein Hulk, nur ohne grüne Farbe.
Mit diesen Vorprägungen ließ ich mich also auf die gut 50-seitige Novelle von Stevenson ein, direkt nachdem ich mit Begeisterung seine „Schatzinsel“ gelesen hatte. Ich war gespannt, mit welchen Erklärungen das psychologische Phänomen eingeführt wird, wie die sinistren Wandlungen Hydes geschildert werden und wie die Doppelidentität auffliegt.
Für alle, die wie bisher ich die Geschichte nicht mehr oder nicht präsent hatten, hier eine Nacherzählung: Der alternde Anwalt Mr. Utterson führt durch die Handlung in London im 19. Jahrhundert. Es sind überwiegend seine Erlebnisse, Eindrücke und Überlegungen, aus denen die Lesenden vom Fall erfahren. Eine sinistre Gestalt namens Mr. Hyde treibt sich in den zwielichtigen Gassen der dichtbesiedelten Stadt herum und fällt durch skrupelloses Verhalten auf. Zum Beispiel rennt er ein Mädchen um und trampelt darüber, wie Utterson von seinem Vetter Enfield erfährt. Hyde ist klein, relativ jung, nicht einfach zu beschreiben, doch dass sein Aussehen irgendwie missfällig und verachtenswert sei und deformiert wirke, lässt auch Utterson ihn erkennen, als er ihn sieht.
Uttersons Jugendfreund, Dr. Jekyll, lebt als ein angesehener Naturwissenschaftler und freundlicher Zeitgenosse in einem ausgedehnten Gebäude mit seinen Bediensteten. Dass Jekyll diesen Hyde protegiert, ihm Zugang zu seinem Haus gewährt und zudem in seinem Testament begünstigt, macht Utterson Sorgen, zumal Jekyll seltsam belastet scheint. Doch es gibt keine weiteren Vorfälle, Hyde taucht fast ein Jahr nicht mehr auf. Als dann ein Mitglied des Parlaments ermordet wird, stellt sich heraus, dass Hyde der Mörder war. In der Folge bricht Jekyll mit seinem Protegé; er scheint wieder der alte. Doch von einem Tag auf den anderen zieht sich Jekyll aus der Gesellschaft zurück, empfängt keinen Besuch mehr und versteckt sich in seinem Labor. Dr. Lanyon, ein gemeinsamer Freund Uttersons und Jekylls, stirbt an einem Schock, der etwas mit Jekyll zu tun haben muss.
Nach etlichen Tagen holt der Diener Jekylls Utterson zur Hilfe: Von Jekyll ist nichts mehr zu hören oder zu sehen, stattdessen treibt sich ein Fremder in dessen Räumen herum. Utterson erkennt dessen Stimme als die Hydes. Schließlich brechen sie die Türe ein, wo sie nur Hyde finden, der sich direkt das Leben nimmt. Er trägt die viel zu großen Kleidungsstücke Jekylls – von dem aber jede Spur fehlt. Aus Briefen Dr. Jekylls und Dr. Lanyons erfahren die Lesenden schließlich, was es mit dem seltsamen Fall Dr. Jekylls auf sich hatte: Ihm war es gelungen, mithilfe einer chemischen Droge seine bösen Persönlichkeitsteile abzuspalten und als Mr. Hyde zu verkörpern. Durch die Droge konnte er die Gestalt wechseln. Doch mit der Zeit geriet die Verwandlung aus den Fugen, immer öfter wurde Jekyll zu Hyde, ohne es zu wollen. So kam es auch dazu, dass Dr. Lanyon Zeuge der Verwandlung – von Hyde zurück zu Jekyll – wurde und über diese Erfahrung nicht mehr wegkam. Am Ende gelangte Jekyll nicht mehr an die Inhaltsstoffe seiner Droge und verharrte im Hyde-Zustand.
Literarisch wie inhaltlich finde ich die Geschichte sehr gut komponiert. Es gelingt Stevenson, die Spannung zu steigern und immer wieder Momente des Unerhörten und des Rätselhaften zu schaffen. Durch die Figur des Utterson in der dritten Person bleibt ein sicherer Abstand, um nicht ins Schaudern hineingezogen zu werden, gleichzeitig ist so viel Nähe da, dass sich Lesende mit ihm wundern. Der Abschiedsbrief aus den Hinterlassenschaften Jekylls wird direkt in die Novelle eingebunden. Daraus erfahren wir aus erster Hand von wissenschaftlichen Interessen an der menschlichen Seele, von den Erfahrungen mit abgespaltener Bosheit und der Enttäuschung, dass der Jekyll-Anteil weiterhin Gut und Böse in sich trägt.
Kleine Nebenbeobachtung: Dass mit Drogen die Welt physisch verändert wird, kenne ich aus Science-Fiction-Geschichten der 1950er bis 1970er Jahre. Genauso begegnen auch multiple Persönlichkeiten als Thema. Hätte nicht Robert L. Stevenson seine Novelle im zwielichtigen London des 19. Jahrhunderts spielen lassen, Philip K. Dick oder Daniel F. Galouye hätten diesen seltsamen Fall auch erfinden können und auf eine Parallelwelt oder einen fernen Planeten gelegt. Es wären vielleicht noch ein paar wissenschaftlich klingende Erklärungen mit Quantenstruktur eingeflossen, doch abgesehen von der alten Sprache ist der Plot mit dem schiefgegangenen Experiment Science Fiction.
Weitere Nebenbeobachtung: Dr. Jekyll hat zwar mit Mr. Hyde einen abgespaltenen Persönlichkeitsanteil. Doch ist er sich dessen bewusst, was Hyde tut. Er kann als Hyde mit Jekylls Handschrift Briefe schreiben, chemische Experimente durchführen und erkennt nur an seiner äußeren Erscheinung, ob er gerade Hyde oder Jekyll verkörpert. Nur sprachlich distanziert er sich von Hydes Tun, indem er von ihm in dritter Person spricht: „He, I say – I cannot say, I.“ Es ist keine Person mit dissoziativer Identitätsstörung!
Mich beschäftigt, wie Stevenson diesen Hyde schilderte: Klein, deformiert, abstoßend, relativ jung, mit behaarten Handrücken (wogegen Jekyll hochgewachsen und wohlproportioniert ist). Hyde ist ein Soziopath, der sich bei Kontakten mit anderen nur schwer zusammenreißen kann, deshalb anderen aus dem Weg geht und durch sinistre Nebenstraßen zieht. Er besitzt bis auf seine unangenehme Ausstrahlung keine Superkräfte. Die Rezeption macht aus ihm ein übergroßes, kraftstrotzendes Wesen, nahezu ein Monster, das zu jeder Gelegenheit mordet. In der Novelle lesen wir von einem einzigen Mord. Ich kann schwer einordnen, was das über unsere Gesellschaft oder eher, Popkultur, sagt und was es im Kontrast über die Vorstellungen von Stevenson und seiner Zeit erzählt.
Hyde ist kein Jedermann. Seine Beschreibung macht ihn zum Exoten, der europäischem Schönheitsideal widerspricht. Alle, die ihn sehen, erkennen, dass er böse ist. Ist das Böse nur noch als übermächtige Riesengestalt denkbar? In Patrick Süßkinds Roman „Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders“ erscheint Jean-Baptiste Grenouille als klein und hässlich und bringt schöne rothaarige Mädchen um. J.R.R. Tolkiens Gollum, wie Dr. Jekyll mit zwei Seelen in der Brust, ist ebenfalls klein und krötig.
Ich denke nicht, dass es die fehlende Vorstellungskraft ist, dass Hyde in der Rezeption größer wird, zu einem bösen Über-Menschen gerät. Für mich liegt der Schlüssel im Nachvollziehen, warum Dr. Jekyll sich freiwillig dem Versuch mit seiner Droge aussetzt. Er möchte in sich die ringenden Persönlichkeitsanteile, das christlich-tugendhaft Gute und das triebhaft Böse, trennen. Er will das Böse absondern. Sozialdarwinistischen und rassistischen Vorstellungen seiner Zeit entsprechend zeichnet sich das Gute durch Wohlgestalt, das Böse, Schlechte durch Missgestalt aus. Dr. Jekyll, groß, ansehnlich, aristokratisch, erscheint als tugendhafter Menschenfreund. Hyde verkörpert den triebgesteuerten Urmenschen, um Erich Kästner zu zitieren: „behaart und mit böser Visage“. Folgerichtig müsste Dr. Jekyll der gute Anteil, Mr. Hide der böse sein.
Doch Stevenson denkt nicht so plump, sondern beschreibt das Experiment als missglückt. Zwar ist Hyde die Verkörperung der Niedertracht. Doch beobachtet Jekyll, dass das böse Verlangen weiterhin in ihm ist, er sich zusammenreißen muss. Er distanziert sich von Hydes Taten, genießt aber auch, dass er das Ausleben der Untugend in dem unbekannten Mann verstecken (hide) kann. Statt sich selbst zu stellen und damit Hyde zu richten, versteckt er sich feige in seinem Haus. Indem Jekyll die Wahl hat, sich für das Gute zu entscheiden, es aber nicht tut, wird er als ganzes selbst zum Bösen. Damit wird mit gängiger Stereotype gebrochen. Das Äußere trügt immer. Das Böse im Menschen lässt sich nie ganz verbergen.
Dieser feine Spin geht in der Adaption der Geschichte leicht unter. In Erinnerung bleibt stattdessen das vereinfachte Gegensatzpaar des guten Dr. Jekyll und des bösen Mr. Hyde. Und dann verschwimmt der Wissenschaftler Dr. Jekyll mit Gestalten wie Dr. Frankenstein oder dem Rabbi aus der Golem-Legende. Es kommt das alte Motiv des außer Kontrolle geratenen magischen Gegenstands zum Tragen, wie es auch in Goethes Zauberlehrling begegnet: Das Böse entsteht aus purem Eigennutz ohne Kenntnis der Folgen. Schließlich hat der menschliche Schöpfer es nicht mehr in der Hand. Mr. Hyde wächst Jekyll sprichwörtlich über den Kopf – so auch in der Rezeption.
Uli in Literatur am 23.08.2025 um 14.24 Uhr
Werkzeuge: |