Dieser Netzauftritt verwendet Sitzungs-Cookies
Näheres erfahren Sie in der Datenschutzerklärung.
Der Blog des Goldseelchen-Verlags
Erkenntnisse aus Stevensons Novelle
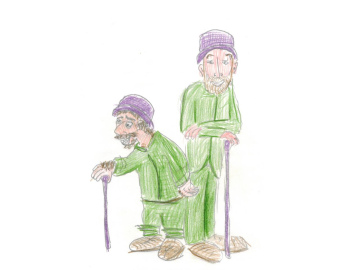
Seite 3 von 3
Mich beschäftigt, wie Stevenson diesen Hyde schilderte: Klein, deformiert, abstoßend, relativ jung, mit behaarten Handrücken (wogegen Jekyll hochgewachsen und wohlproportioniert ist). Hyde ist ein Soziopath, der sich bei Kontakten mit anderen nur schwer zusammenreißen kann, deshalb anderen aus dem Weg geht und durch sinistre Nebenstraßen zieht. Er besitzt bis auf seine unangenehme Ausstrahlung keine Superkräfte. Die Rezeption macht aus ihm ein übergroßes, kraftstrotzendes Wesen, nahezu ein Monster, das zu jeder Gelegenheit mordet. In der Novelle lesen wir von einem einzigen Mord. Ich kann schwer einordnen, was das über unsere Gesellschaft oder eher, Popkultur, sagt und was es im Kontrast über die Vorstellungen von Stevenson und seiner Zeit erzählt.
Hyde ist kein Jedermann. Seine Beschreibung macht ihn zum Exoten, der europäischem Schönheitsideal widerspricht. Alle, die ihn sehen, erkennen, dass er böse ist. Ist das Böse nur noch als übermächtige Riesengestalt denkbar? In Patrick Süßkinds Roman „Das Parfüm. Die Geschichte eines Mörders“ erscheint Jean-Baptiste Grenouille als klein und hässlich und bringt schöne rothaarige Mädchen um. J.R.R. Tolkiens Gollum, wie Dr. Jekyll mit zwei Seelen in der Brust, ist ebenfalls klein und krötig.
Ich denke nicht, dass es die fehlende Vorstellungskraft ist, dass Hyde in der Rezeption größer wird, zu einem bösen Über-Menschen gerät. Für mich liegt der Schlüssel im Nachvollziehen, warum Dr. Jekyll sich freiwillig dem Versuch mit seiner Droge aussetzt. Er möchte in sich die ringenden Persönlichkeitsanteile, das christlich-tugendhaft Gute und das triebhaft Böse, trennen. Er will das Böse absondern. Sozialdarwinistischen und rassistischen Vorstellungen seiner Zeit entsprechend zeichnet sich das Gute durch Wohlgestalt, das Böse, Schlechte durch Missgestalt aus. Dr. Jekyll, groß, ansehnlich, aristokratisch, erscheint als tugendhafter Menschenfreund. Hyde verkörpert den triebgesteuerten Urmenschen, um Erich Kästner zu zitieren: „behaart und mit böser Visage“. Folgerichtig müsste Dr. Jekyll der gute Anteil, Mr. Hide der böse sein.
Doch Stevenson denkt nicht so plump, sondern beschreibt das Experiment als missglückt. Zwar ist Hyde die Verkörperung der Niedertracht. Doch beobachtet Jekyll, dass das böse Verlangen weiterhin in ihm ist, er sich zusammenreißen muss. Er distanziert sich von Hydes Taten, genießt aber auch, dass er das Ausleben der Untugend in dem unbekannten Mann verstecken (hide) kann. Statt sich selbst zu stellen und damit Hyde zu richten, versteckt er sich feige in seinem Haus. Indem Jekyll die Wahl hat, sich für das Gute zu entscheiden, es aber nicht tut, wird er als ganzes selbst zum Bösen. Damit wird mit gängiger Stereotype gebrochen. Das Äußere trügt immer. Das Böse im Menschen lässt sich nie ganz verbergen.
Dieser feine Spin geht in der Adaption der Geschichte leicht unter. In Erinnerung bleibt stattdessen das vereinfachte Gegensatzpaar des guten Dr. Jekyll und des bösen Mr. Hyde. Und dann verschwimmt der Wissenschaftler Dr. Jekyll mit Gestalten wie Dr. Frankenstein oder dem Rabbi aus der Golem-Legende. Es kommt das alte Motiv des außer Kontrolle geratenen magischen Gegenstands zum Tragen, wie es auch in Goethes Zauberlehrling begegnet: Das Böse entsteht aus purem Eigennutz ohne Kenntnis der Folgen. Schließlich hat der menschliche Schöpfer es nicht mehr in der Hand. Mr. Hyde wächst Jekyll sprichwörtlich über den Kopf – so auch in der Rezeption.
Uli in Literatur am 23.08.2025 um 14.24 Uhr
Werkzeuge: |